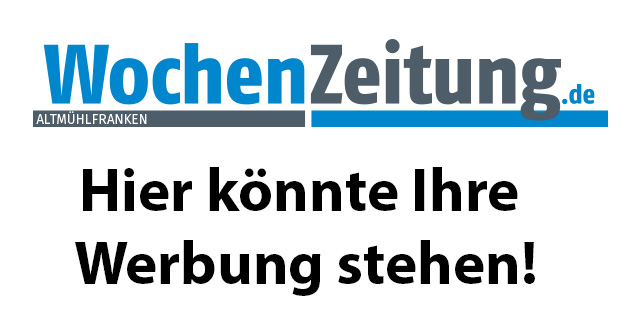Klimaneutralität und Biodiversität in der Praxis
Kommunen, Unternehmen & Landwirte aus Mittelfranken und der Oberpfalz zeigen lokales Handeln
(red). Mitte Juli haben sich die Akteure aus dem Projekt „Klimalandwirtschaft“ aus Kastl und dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen in Triesdorf zum Projekttag „Klimaneutralität und Biodiversitätssteigerung“ getroffen. Im Mittelpunkt standen Erfahrungsaustausch und erste Bilanzierung nach eineinhalb Jahren Projektlaufzeit. Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten fördert das Projekt, das in Triesdorf am Fachzentrum für Energie und Landtechnik (FEL) als Projektträger umgesetzt wird. Ziel ist es, sowohl Kommunen und Unternehmen als auch die beteiligten Landwirte auf dem Weg hin zur Klimaneutralität, sowie bei Erhalt und Erhöhung der Biodiversität auf deren Flächen zu unterstützen. Neben den eigenen Maßnahmen zur Emissionserfassung und ‑reduktion ist ein Kooperationsmodell zwischen Kommunen bzw. Unternehmen und Landwirten das Herzstück des Projekts. Mit regionalen Partnerschaften werden dabei freiwillige Wertschöpfungspakete für Biodiversität und Klimaschutz geschnürt. Franziska Sippl, die das Projekt am FEL betreut, gab einen Einblick in ihre Arbeit und die bisherigen Ergebnisse. In der Oberpfalz starteten im Mai 2021 die Marktgemeinde Kastl als Kommune, ein Pharmaunternehmen und drei Landwirte ihre Patenschaften. Im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen begannen im Sommer 2022 neun Kommunen, elf Unternehmen und fünf Landwirte ihre Kooperation. Dabei wurden viele verschiedene Aktivitäten umgesetzt: Neben einem Bildungsprogramm reichen sie von Emissionserfassung und ‑reduktion durch Klimaschutzmaßnahmen über die Speicherung von CO2 bis hin zu Biodiversitätsmaßnahmen. Um die Besonderheiten der heimischen Flora und Fauna zu beachten, wird das Projektteam von lokalen Naturschutzeinrichtungen und ‑verbänden unterstützt, z.B. Landschaftspflegeverband Mittelfranken und Naturpark Hirschwald. Die BayWa AG tritt als Mittler zwischen den Paten und Landwirten auf, kümmert sich um Verträge, Bodenbeprobungen zum Nachweis von Veränderungen des Humusstatus und die Anerkennung von Nachhaltigkeitszertifikaten.
Kurt Herbinger, Projektleiter der BayWa AG, zog für die Patenschaften im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen Bilanz. Dort ist es mit den beteiligten Landwirten gelungen, etwa 360 ha unter Vertrag zu nehmen. Herbinger hatte zudem gute Nachrichten für die Projektpartner: Im März 2023 ist es der BayWa AG mit der QAL-Umweltgutachter GmbH gelungen, die erste Zertifizierung zu bekommen. Die Paten werden noch im Laufe des Jahres die entsprechenden Urkunden in Händen halten können. Damit können die Landwirte die Optionen der CO2 Senken endlich auch sichtbar machen und die Paten können mit den Zertifikaten ihr Nachhaltigkeitsengagement dokumentieren.
Zu den Projekterfahrungen aus Sicht eines Landwirts sprach stellvertretend Norbert Bleisteiner (Kastl/Oberpfalz). Die Beteiligung am Projekt gründet für ihn auf drei Aspekten: 1. Gewinnung von Image durch Maßnahmen zur Steigerung der Biodiversität und Öffentlichkeitsarbeit. Nach Aktionstagen zur Heckenpflege und Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern erfährt er heute mehr Verständnis und Wertschätzung für seine Arbeit. 2. Aus pflanzenbaulicher Sicht ist es für ihn interessant, dass seine Betriebsflächen systematisch auf Humusgehalte beprobt werden und er die Auswirkungen seiner landwirtschaftlichen Maßnahmen beobachten und Folgen nachvollziehen kann. 3. Aus ökonomischer Sicht ist die Patenschaft aktuell noch nicht so interessant. Da muss die Zukunft erst noch zeigen, ob sich eine angemessene Entschädigung des Aufwands für Arbeit und Dokumentation auch finanziell realisieren lässt. Landwirt Johannes Hüttner (Amberg/Oberpfalz) bestätigte Bleisteiner und brachte eine weitere Herausforderung in die Diskussion ein: In der Praxis sei die Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen am Wegrand (z.B. Heckenpflege) schwierig. Es würden schnell Unstimmigkeiten über Besitzverhältnisse und Zuständigkeiten von Hecken und Bäumen aufkommen. Viele Eigentümer schrecken vor neuen Pflanzungen zurück. Gepflanzt ist schnell, doch wer übernimmt die langfristige Pflege und Erhaltung? Zudem besteht die Angst, dass neue Biotope entstehen und man sich damit zusätzliche Auflagen einholt. Hüttner unterstützt den Aspekt des Humusaufbaus, doch er sieht, angesichts des Klimawandels, besondere Herausforderungen, diesen auch umzusetzen und nachzuweisen. Die Humusverhältnisse im Boden unterliegen vielfältigen Einflussfaktoren, die nicht allein in der Arbeit und Wirtschaftsweise der Landwirte gründen.
Stefan Braun, erster Bürgermeister der Marktgemeinde Kastl, berichtete über seine Erfahrungen als Vertreter einer Kommune. Auch er habe bemerkt, dass viele Landwirte bei weiteren Maßnahmen zur Steigerung der Biodiversität eher reserviert sind. In diesem Zusammenhang lobte er die fachkundige Projektbegleitung durch das Fachzentrum für Energie und Landtechnik. Solche Prozesse brauchen Aufklärung, Moderation für die Öffentlichkeit und Abstimmung zwischen den Partnern. Er sieht seine Kommune auf einem guten Weg. In Kastl ist es mit eigenen Maßnahmen gelungen, die CO2-Emissionen bereits deutlich zu reduzieren. Braun schätzt sehr die lokalen Kompensationsmöglichkeiten durch die Kooperation mit den Landwirten vor Ort. Wichtig ist für ihn, dass man auch transparent macht, was getan wird. Ganz unter dem Motto der Aktionstage in Kastl „Sehen-Anfassen-Tun“!
Von der Rolle des Naturparks Hirschwald berichtete dessen Geschäftsführerin Isabel Lautenschlager. Sie und ihre Mitarbeiter unterstützten und beteiligten sich an verschiedenen Maßnahmen, von Obstbaumpflanzungen, Aktionstagen zur Heckenpflege, Aufhängung von Nistkästen, Humusuntersuchungen, Bildungsmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit. Herausragend ist für Lautenschlager das gemeinsam entwickelte Bildungsangebot für Nachhaltige Entwicklung für Grund- und Mittelschulen. Auch hier wurde unter dem Motto „Sehen-Anfassen-Tun“ gearbeitet. Die Schülerinnen und Schüler packten tatkräftig bei der Heckenpflege mit an. Es wurden Hecken auf Stock gesetzt, Bäume gepflanzt und Nistkästen aufgehängt. Mit der konkreten Zusammenarbeit der Partner in Kastl hatte sie auch das ideale Praxis-Beispiel für ihre bayerischen Naturpark-Kollegen. Für sie geht der Weg weiter – das Monitoring der Flächen in Kastl-Mennersberg, die Maßnahmen mit den Landwirten, aber auch das Bildungsangebot für Schulen und Kitas.
Auch Landrat Manuel Westphal (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) zeigte sich zufrieden. Neben den acht Kommunen und elf Unternehmen übernahm auch der Landkreis selbst eine Patenschaft (30 ha). Wichtige Pluspunkte sind für ihn die tolle Begleitung bei der Umsetzung sowie das Monitoring seitens des FELs. Die Zertifizierung des Projekts und die fortgeschrittene Auditierung runden für ihn das Projekt ab. Die Beteiligung am Projekt bringe viele Vorteile für Gesellschaft und Klimapaten.
Biodiversität und Umweltmaßnahmen konnten alle Akteure im Pomoretum der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf im Rahmen einer Führung erleben. Gärtnermeister Simon Schnell erläuterte die Anlage mit 1700 Sorten Äpfel, Birnen und Zwetschgen. In Triesdorf werden die verschiedenen Anbauoptionen in der Praxis gezeigt: von Streuobstgelände, klassischer Anlagenpflanzung mit Halbstammbäumen und Spindelbäumen zur Sortensicherung. Pflegeaufwand, Arbeitsprozesse und Biodiversitätswirkung unterscheiden sich dabei enorm. Kurz gesagt, Streuobstwiesen sind für Sortenerhaltung und Biodiversität wertvoller. In der Realität entscheiden Verbraucherinnen und Verbraucher mit ihren Kaufentscheidungen über die Gestaltung der Anbauverfahren und die Vielfalt im Obstanbau. Wichtig ist, Verständnis zu schaffen und Biodiversität integrativ zu gestalten.
Das Projekt wird fortgesetzt und ist offen für weitere Interessenten, Landwirte, Kommunen und Unternehmen oder Finanzdienstleister. Weitere Informationen sowie ein ausführliches Video zum Projekt sind auf der Homepage der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf verfügbar (https://www.triesdorf.de/projekte-fel). Interessenten wenden sich bitte an Franziska Sippl, Fachzentrum für Energie und Landtechnik Triesdorf (franziska.sippl@triesdorf.de).
Annette Schmid FEL Triesdorf
Bildunterschrift: 11.07.2023 Gruppenbild Projekttag „Klimaneutralität und Biodiversitätssteigerung“
Foto: Annette Schmid